 Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch
 1. Danksagungen
1. Danksagungen
Hans Groschwitz
 2. Hauptmenü und Systemdialoge
2. Hauptmenü und Systemdialoge

Bild U1: Eröffnungsdialog mit Rollbalken
Dafür eignet sich ein Eintrag in der Datei ema-xps- init.lisp, die EMA-XPS während der Bootphase lädt.

Bild U2: Das Hauptfenster des Grafikservers
a)
|
b)
|
c)
|
d)
|
Bild U3: Die Pulldown-Menüs des Hauptfensters
a)
|
b)
|
c)
|
Bild U4: Vom Grafikserver initiierte Systemdialoge
| Wissensbasen, die unter Babylon-2 erstellt worden sind, können von EMA-XPS nicht korrekt eingelesen werden. Vorbehandlungen dieser Dateien sind in geringem Umfang notwendig. |
a)
|
b)
|
Bild U5: Von der LISP-Welt initiierte Systemdialoge
 3. Debugger PAD
3. Debugger PAD

Bild U6: Der LISP Debugger PAD von EMA-XPS v2.1
 4. Erklärungskomponente
4. Erklärungskomponente

Bild U7: Erklärungsfenster
 5. Tracer
5. Tracer

Bild U8: Tracer
 6. Editoren
6. Editoren
 6.1 Der Taskmechanismus von EMA-XPS
6.1 Der Taskmechanismus von EMA-XPS
|
|
Bild U9: Definition und Aufrufform einer Task unter EMA-XPS

Bild U10: Task-Editor
 6.2 Editor für die Regelverarbeitung
6.2 Editor für die Regelverarbeitung

Bild U11: Regeleditor mit bearbeiteter Regel sowie das Datei-Menü des Hauptfensters mit der grafischen Aufbereitung der Kontrolldaten über die geladenen Wissensbasen

Bild U12: Dialog zur Umsortierung von Regeln innerhalb einer Regelmenge
 6.3 Editoren zur objektorientierten Programmierung
6.3 Editoren zur objektorientierten Programmierung

Bild U13: Frame-Editor

Bild U14: Instanz-Editor

Bild U15: Behavior-Editor
 6.4 Editoren für den Constraint-Mechanismus
6.4 Editoren für den Constraint-Mechanismus

Bild U16: Editor für primitive Constraints

Bild U17: Editor für Constraint-Netze
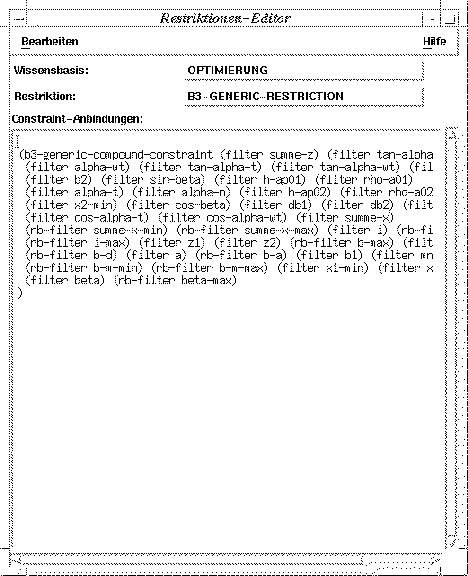
Bild U18: Restriktionen-Editor
 6.5 Der Prolog-Editor
6.5 Der Prolog-Editor

Bild U19: Prolog-Editor mit Zuordnungsdialog für Klauselmengen
 6.6 Editor für sonstige Wissenskonstrukte
6.6 Editor für sonstige Wissenskonstrukte

Bild U20: Editor für sonstige Konstrukte
 7. Hilfewerkzeug
7. Hilfewerkzeug

Bild U21: Hilfewerkzeug mit Browser
 8. Die Endbenutzerschnittstelle und ihre Dialoge
8. Die Endbenutzerschnittstelle und ihre Dialoge
| Druck- knopf mit Be- schrift. | Feld mit Be- schrift. | Druck- knopf mit Grafik | Feld mit Grafik | Trenn- linie | Ausgabe- Text- fenster | Eingabe- Textfeld | Menü | Menü- eintrag | |
| ui-set/get- geometry | O | O | O | O | O | O | O | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ui-set/get- foreground | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| ui-set/get- background | X | X | X | X | - | X | X | - | - |
| ui-set/get- font | X | X | - | - | - | X | X | - | - |
| ui-set/get- bitmap | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
| ui-set/get- alignment | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| ui-set/get- text | X | X | - | - | - | O | - | X | X |
| ui-add- text |
- | - | - | - | - | O | - | - | - |
| ui-set/get- mnemonic | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| ui-set/get- callback | O | - | O | - | - | - | - | - | O |
| ui-set/get- visibility | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ui-set/get- sensitivity | O | - | O | - | - | - | O | O | O |
Tabelle U1: Resourcen der Grundelemente der Endbenutzerschnittstelle

Bild U22: Ausschnitt aus einer Sitzung mit dem Expertensystem DANTEX unter der Schale babylon-3

Bild U23: Ausschnitt aus einer Sitzung mit dem Expertensystem DANTEX unter der Schale EMA-XPS v2.1
 9. Die Online-Hilfeseiten von EMA-XPS
9. Die Online-Hilfeseiten von EMA-XPS
HAUPTMENÜ SITZUNGSFENSTER FEHLERWERKZEUG ERKLÄRUNGSFENSTER TRACER EDITOREN FRAME-EDITOR INSTANZ-EDITOR BEHAVIOR-EDITOR REGEL-EDITOR PROLOG-EDITOR CONSTRAINT-EDITOR CONSTRAINTNETZ-EDITOR RESTRIKTIONEN-EDITOR TASK-EDITOR SONSTIGES-EDITOR
